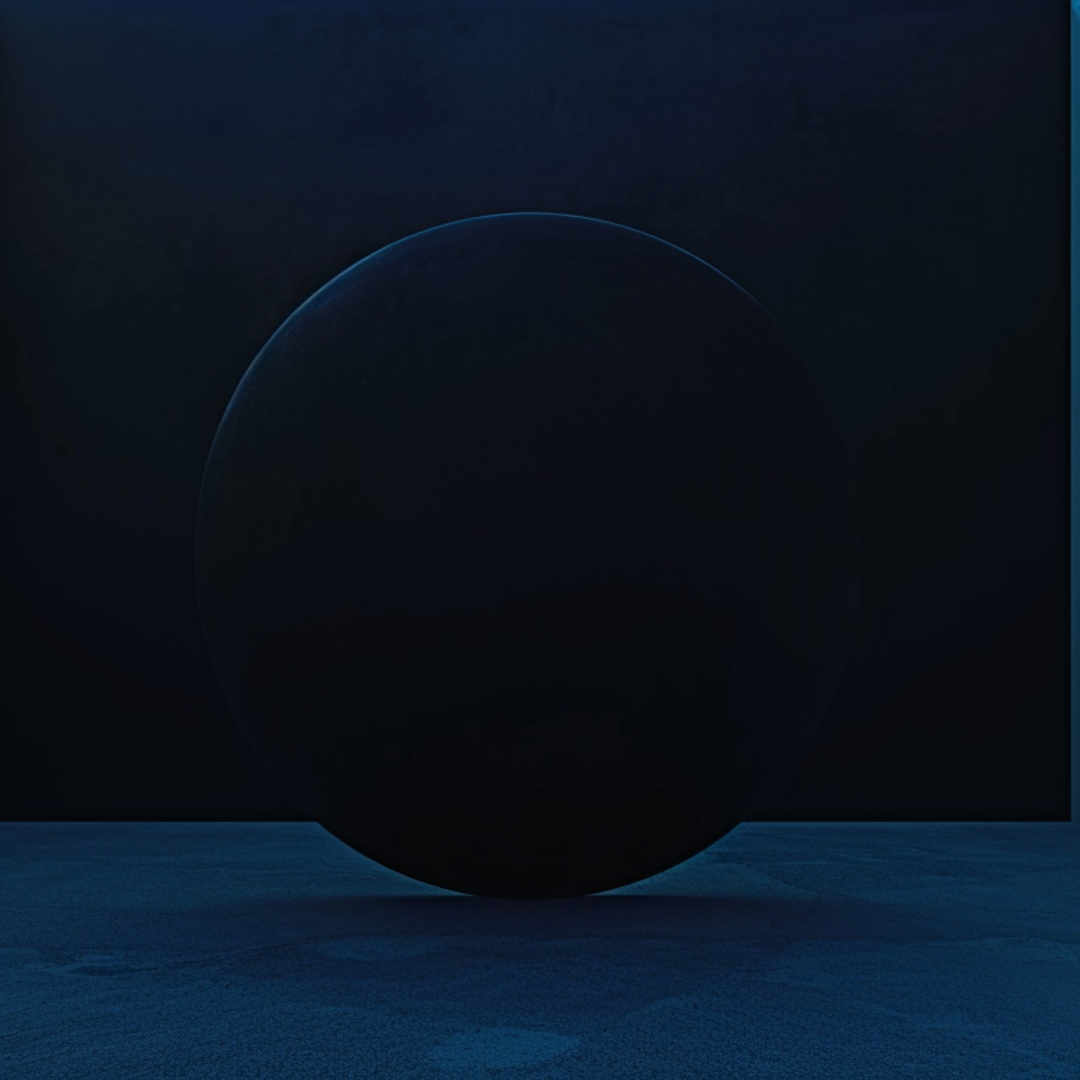Im letzten Post habe ich von einem erfahrenen Geschäftsführer erzählt, dessen Kontrollbedürfnis tief verankert war –
und davon, wie sich durch einen Moment des Loslassens etwas verändern konnte.
Heute geht es um das,
was viele kluge, reflektierte und verantwortungsvolle Menschen antreibt –
und gleichzeitig limitiert.
Kontrolle ist oft kein Charakterzug.
Sondern eine erlernte Überlebensstrategie.
Wenn das Leben früher unberechenbar war,
wenn emotionale Überforderung nicht gehalten wurde, wird Planen zur Sicherheit.
Gedankliche Kontrolle ersetzt emotionale Haltlosigkeit.
Denn: Wenn ich denke, muss ich nicht fühlen.
Das Denken wird zur Schutzschicht.
Das Fühlen zum Risiko.
Und so entsteht ein tiefes inneres Muster:
„Ich muss vorbereitet sein. Ich muss alles im Griff haben.
Sonst passiert etwas, das ich nicht halten kann.“
Es ist weniger: Ich darf keinen Fehler machen.
Und viel mehr: Wenn ich loslasse, passiert etwas Schlimmes.
In diesem Funktionsmodus wird Führung zur Daueranspannung.
Professionell – aber nicht mehr lebendig.
Organisiert – aber nicht mehr verbindend.
Und für Mitarbeitende bedeutet das:
Ständiger Anpassungsdruck.
Denn wer kontrollieren muss, hat genaue Vorstellungen, wie es laufen soll.
Und wer delegiert, erwartet (unausgesprochen),
dass es genau so umgesetzt wird.
Das hemmt Eigenverantwortung.
Es verhindert kreative Lösungen.
Und es entzieht dem Team den Raum,
sich auf eigene Weise einzubringen.
Funktionsmodus trennt von Kontakt.
Kontrolle verhindert Vertrauen.
Nicht noch ein besserer Plan.
Sondern das tiefere Verstehen:
Das Leben lässt sich nicht kontrollieren.
Egal, wie sehr wir es versuchen.
Was bleibt, ist immer nur eine Bemühung –
und die macht uns hart. Angestrengt. Zwanghaft.
Und das kostet Kraft –
und macht Wirkung klein.
Der erste Schritt ist nicht das Tun.
Sondern eine innere Bewegung –
vom Denken zum Spüren,
von Kontrolle zu Vertrauen,
vom Reagieren zur In-Kontakt-Sein.
Was versuchst Du zu kontrollieren –
nicht, weil Du es willst,
sondern weil Du Angst hast, was passiert, wenn Du es nicht tust?